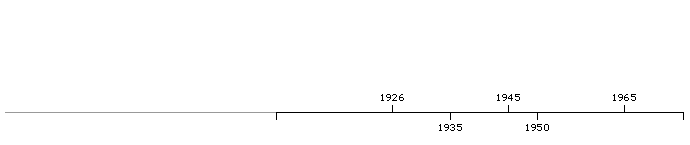|
|
|
Künstlerische Intentionen
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hier sind unveröffentlichte Texte Rudolf Szyszkowitz’ und Auszüge aus seinen Skizzenbüchern zu finden, welche die Denkweise des Künstlers verdeutlichen sollen.
Für ein geplantes Szyszkowitz -Buch, das nie zu Stande kam und statt dem einige Jahre später die Szyszkowitz -Biographie von Wilfried Skreiner erschien, schrieb Rudolf Szyszkowitz 1971 einige Textpassagen, die seine künstlerischen Intentionen beschreiben sollten:
Künstlerische Hauptwerke sind die Ölgemälde; immer wieder tief innere menschliche Thematik behandelnd, die Graphik neben der Malerei behandelt Variationen meiner Hauptbildthemen.
Die leidenschaftliche Verbundenheit, mit allem was mir begegnet und in das ich mich versenke, verschwistert mit der Landschaft und ihren Farben und anmutigen Elementen, und alles in allem der Mensch, lässt im Maler das innerste Interesse für den innersten Menschen und seine Einsamkeit wachsam sein.
Mich fesselt der Mensch und sein Charakter, sein Tiefgang. Aus diesem Streben entstehen viele Bildnisse, darunter sehr viele Blätter, die die starke Zartheit des Kindes schildern.
Landschaft, ihr Raum und Mensch und was dem Menschen Halt zu bieten tauglich erscheint, gehört zusammen; alle Werte sollen uns - den Schaffenden - wie Schutzgeister Beistand leisten.
Ich halte eine künstlerische Arbeit dann für gut und meinen Vorstellungen entsprechend, wenn sie durch die innersten und die äußeren Begegnungen mit dem, was rund um und im Künstler vor sich geht, entsteht, und durch die entsprechenden Mittel seines Ausdrucks seinen Niederschlag erfährt;
Gut-Ab-Normes im Ausdruck soll über der sicheren Beherrschung der Normen liegen; die sichere Beherrschung der Form soll wie ein gesetzlicher Halt sein - immer bereit.
Im Verlauf der Jahrzehnte meiner künstlerischen Arbeit festigte sich immer klarer die Überzeugung, daß die Höhepunkte der uns überbrachten, ererbten künstlerischen Werte nie ausschöpfbar waren und bleiben; daß die in uns erfahrbaren Höchstwerte zum Immer-Neuen gehören; daß alle Spitzenwerte der Vergangenheit, die uns auf unseren geistigen Wegen tangieren (begegnen), immer das Mit-Neue sind, gemeinsam mit dem Erregenden, das jeder sinnlich, geistig Empfängliche durch den Zusammenstoß mit dem Direkten auf seinem Weg beziehungsweise aus seinem Weg erfährt.
Die „alten“ Neuheiten entlarven sich plötzlich als ungehobene Wahrheiten, die wie ein Funken sich mit der neuen, direkten Wirklichkeit verbinden; der neue Funke verbindet sich mit der aus der Zeitzündung entflammten dauernden Wirklichkeit;
Die künstlerischen Werte der Vergangenheit und die künstlerischen Werte der Zukunft sind ein Wert, wenn er entsprechend durchlichtet ist, entsprechend ent- deckt ist.
Szyszkowitz über seine Arbeitsintentionen
Die LandschaftDie Formensprache der Gräser zu beiden Seiten des Dahinschreitenden ist unendlich und vielfältig; das Auge verliert sich im Gewirr der Vielfalt und das Unbewältigbare zwingt zur Besinnung.
Der menschliche Ordnungswille tastet sich an den Reichtum heran; aus diesem Ordnungsbestreben wächst das menschliche Bild und nimmt den Streit mit dem göttlichen Bild auf.
Aus dem Sehnsüchtigen in die Täler, in die Berge, die Hügel und die weiten Ebenen zu den Seen, den Strömen und den Meeren erstehen die Blätter, die die aufregend ruhigen und aufregend bewegten Eindrücke des Wanderers dokumentieren.
Es wird nach außen und nach innen gleichzeitig gewandert; die von menschlicher Hand stammenden Bauten und deren Reste, Halbreste und neuere Anstrengungen (Ruinen, Städte, Orte) tauchen aus der Landschaft, graben sich ein, steigen heraus.
Die Ordnungen dieser Beziehungen geben fast durchwegs ein künstl. , dramatisches Thema/ Gebilde ab; spannungsmäßig, rhytmisch, dynamisch, kontrapunktisch im Hell-Dunkel, in Auflösung und Ballung zugleich.
Das Unheimliche des Wassers, des bewegten und des stillen, das Unheimliche des Meeres und der Seen, das Schiff/ das Boot mit der dünnen Bauwand bewegt sich hinaus in furchtbare Tiefen; Wegfahren, Ab-Scheiden, Abschied.
Oder das Unheimliche des tiefen Waldes, die heroische Einsamkeit, die rastlose Sehnsucht, die stete Last des Unerklärbaren und die stete Freude an den „Enden Gottes“, die Lichter im Dunkeln- oft angeführte Themen.
Das AquarellDie „Aufzeichnungen“ (dichterisches Erfassen) geschehen mit der fließenden Farbe; mit der Farbe wird das Thema aufgebaut; es entsteht zellenartig wachsend, bis zum Ende der Aussage Notwendigkeit.
Das immer Unheimliche, wenn auch schaurig Beglückende der Lüfte, der Gebilde am Himmel, die Wandlungen der Luftfarbklänge, der Kämpfe im Drama des Himmels verwoben mit dem Düsteren und Lichtwallungen der Erde....
Das BildnisZu den großen Leidenschaften gehört die Betrachtung und Schilderung eines menschlichen Hauptes, auf dem sich das Antlitz herausgräbt.
Die Spannung der Form aus den vielfältigen Formen, Form gegen Form, Antlitz gegen Antlitz, Massen und Winkel gegeneinander ins Treffen geführt.
Ein dramatischer Vorgang, Härte und Milde, Macht, Gewalt und Anmut im Contra;
das Geringste von Winkel und Masse verändert den Charakter des Hauptes, des Menschen Antlitz.
Die Ballung und Zusammenfassung vieler, vieler entdeckter Formbewegungen und Änderungen lassen ein Bildnis auftreten; eine Dicht-ung.
Das KinderbildNur wer die monumentale Gewalt des Zarten aus seiner Gewalt dramatischer Tiefe herauszuholen vermag, begreift die eminente künstlerischen Kraft, die zur Schilderung eines Kindes erforderlich ist.
Das Expressive der drängenden, vehement herauswollenden, gierigen, besitzsüchtigen, der dichtesten, kleinen Augen des Kindes, das Anfangen mit aller Gewalt, die erschreckende „Deutlichkeit“ der Öhrchen und die formale Klarheit des Inner-Innersten des gesamten Gewächses: Kind ist eine vornehme und gleichzeitig höchste künstlerische Aufgabe. Die Gefahr des Unbewältigbaren tritt hier beängstigend an den Wagenden heran, und die Übermacht des Themas (Rilke „bewältigt“ die Rose sprachlich) treibt den Unfähigen in die brutalst verteidigte Kapitulation.
Ich habe wiederholt empfunden, daß das Haupt eines Kindes in seiner deutlichen Dichte und strotzend aufkeimenden Form vielmehr Erhabenes aussagt, als der bedrängte Kopf des Erwachsenen.
Es ist eben die dichte Anmut des Frühlings voll Gewalt.
Dem Starken erscheint der Blick eines Kindes stärker als alle Stärke-Sinnbilder (wie Schwert und Gewehr, Panzer und flammender Superbomber); die Waffe ist trotz, trotz, trotz allem ein mächtiges Sinnbild der Schwäche. Der gewaltige Gegensatz zwischen der Form des Kindes und der des ausgereiften Menschen steigert die Befähigung, den Erwachsenen um so treffender schildern zu können.
In den 30er Jahren hatte Rudolf Szyszkowitz immer Skizzenbücher bei sich, in denen er neben Bildeindrücken und Studien auch immer wieder Gedanken festhielt.
Hier einige Auszüge daraus:
28.6.1930
Wenn sie heute ein Bild für reif erklären, so ist damit nur die „technische Reife“ gemeint, denn die wahre Reife in einer Arbeit erkennen sie nicht.
3.11.1930
Ich will meinen Trotz mit meiner ganzen Liebe nähren.
Den Trotz gegen das Erstickende um den Funken des Ideals.
15.11.1930
Im Leid, im Werk, mit dem das Ringen im Leben erfüllt ist, das Glück zu erkennen und es so immer vor Augen zu haben, scheint mir zuerst erstrebenswert um Christi Willen.
Jänner 1931
Es wird meine Aufgabe bleiben in meiner Kunst das, was ich sehe, spüre, und täglich verwundert erlebe, (denn aus der Verwunderung komme ich nicht mehr heraus), zu fassen suchen und mit dem Wunder der Erlösung durch Christus zu durchdringen.
Gott helfe mir dazu.
Ist solche Arbeit in meinem Werk gelungen, so gehört es alle Zeiten und wider alle Zeiten IHM; das glaube ich.
3.2.1931
Die Arbeit so zerstreuen lassen? (das geht nicht, das darf nicht sein!)
Immer den Kontakt aller Arbeiten aufrecht zu erhalten suchen, daß sie geschlossen eines darstellen.
10.2.1931
Wenn ein Bild von vornherein Expression werden soll, wird es das nicht (meistens nicht). Aber im Nachhinein kann man oft sagen, das oder jenes Bild hat Expression. Expression: darunter habe ich bis heute nur einfältig das verstanden, was ich aus dem Wort verstehen konnte und was ich besonders stark in den Bildern der alten Maler (Giotto) zu sehen, zu empfinden glaubte und glaube.
15.2.1931
Es ist nicht anders: Die Kunst ist dazu, die, denen sie begegnet, zur Besinnung oder zur Verinnerlichung der Besinnung des inneren oder äußeren Schönen zu bringen.
März 1931
Damit mir der Unterstützungsverein nicht die Unterstützungen entzieht, sind wir (Schützlinge desselben) aufgefordert worden auf dem Faschingsrummel im Künstlerhaus Dienst zu tun. - jetzt am Morgen nach Hause gekommen; mein Eindruck ist schrecklich!
Es war eine Schande für Deutschtum, Kunst und Heimat. Eine Schande vor allem für Ethik und Christentum.
Ein Ball ist die schwerste Aufgabe, die selbst ganz gefestigte, innerlich reine, starke Menschen auf sich nehmen können - aber so ein „Fest“ haltlosen Menschen zu überlassen, bei einem so klaffenden Fehlen jeder Seelenkultur - es war die Situation unter dem Tier.
Wie Urin hat mich das „Fest“ angeglotzt; solche Feste dürfen wir nicht halten.
25.10.1931
Ich bin mir alles - das größte Wunder bin ich mir selbst - denn wie könnte ich alle anderen Wunder leben, wäre nicht deren herrlichstes Wunder ich.
3.11.1931
Man muß das eigene Leid genießen können, wie die eigene Freude.
Im Genuß des eigenen Leides sieht man in die Ewigkeit; das steht schon dafür.
November 1931
Ungerechtes Geschlecht der Maler.
So ungerecht, wie ihr Maler gegeneinander seid, ist keine andere Zunft. Soviel Liebe ihr auch in die Kunst gießt, soviel euch auch Liebe zur Menschheit in die Bahnen der Kunst treibt - lieblos aber seid ihr untereinander.
April 1932
Was Mittel ist muß Mittel bleiben - darf nicht zur Grundlage werden.
5.5.1932
Wie eine Wolke geht Nietzsche über die Sonne, schwarz und blutig; just damit man, wenn sie vorübergezogen ist, die Leuchtkraft besser sieht.
Mai 1933
Formen noch nicht wissen, sie aber ahnen (glauben) können, ist groß.
Formen wissen, sie aber nicht mehr oder noch nicht ahnen können, ist jämmerlich (denn es ist ein bodenloses Scheinwissen).
(aus einem Brief an die Gemeinschaft katholischer Akademiker in Graz von 1947)
Der heute künstlerisch Schaffende stößt aus seinem Talent empfindend, hart auf den Begriff des Zeitlichen, des Gewesenen, des Gegenwärtigen und des Kommenden; er ist gezwungen sich mit diesen Vorstellungen sofort auseinanderzusetzen.
Der gewissenhaft Suchende erfährt den Urkultbegriff als die ruhende Kugel seines Lebenssinnes.
Das unerlöste Material ist längst ein drohender Wegweiser geworden; erhabene Anstrengungen durch Natur und Realität zur Sinnmitte vorzustoßen bleiben solange zum Scheitern verurteilt, als die Einverleibung in den zeitlosen Nährboden der Geistmitte nicht geschieht.
Das kultische Versagen und seine Ursache erscheinen vielfach klar begriffen; das zeitgemäße Denken und Empfinden versperrt die fruchtbaren Wurzeln des Bedeutenden.
Der brauchbare Herzensgrund ist die einzig noch berechtigte und sinnhafte Werkbasis.
aus einem Brief von 1966
Das alltäglich „akademisch“ oder auch journalistische Geplätscher ist allüberall so über die Ufer des Geistigen in eine Überwasserzone unverbindlicher Doofheit getreten, daß man davon nichts mehr hören und lesen will.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| |
|
|